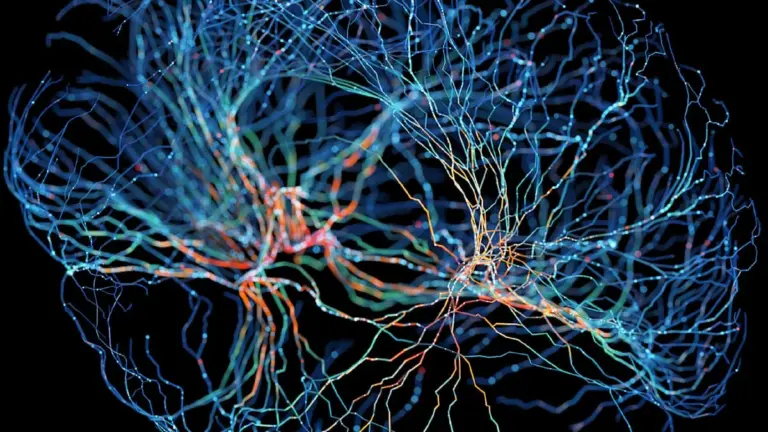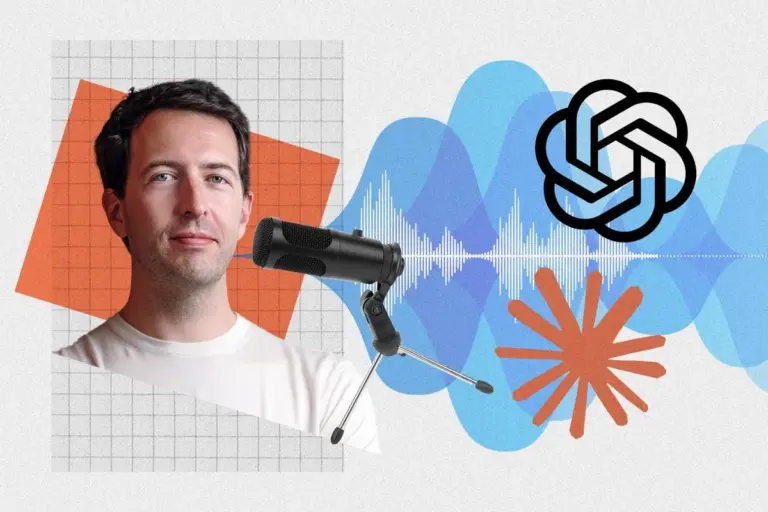Sie lieben den Trubel der Großstadt? Die unendlichen Möglichkeiten, die kurzen Wege, das sofort verfügbare Croissant um 22 Uhr? Geht mir genauso. Ich bin in der Bay Area aufgewachsen und habe meine Kinder in Seattle großgezogen. Das Bild vom entspannten Leben auf dem Land? Ein Mythos, dachte ich, bis ich diese einsame Insel im Pazifischen Nordwesten entdeckte.
Nun bin ich hier – nicht für einen Kurzurlaub, sondern für drei harte Monate. Ziel: Herauszufinden, ob der Stadtpuls wirklich raus muss. Doch schon in der ersten Woche erlebte ich einen Schock, der mir hätte klar machen müssen: Das ist kein Wellness-Retreat.
Der böse Empfang: Mäuse statt Meeresrauschen
Ich suchte meine Sonnenbrille im Handschuhfach und fand stattdessen einen Nager-Snack. Ein angebissenes Müsliriegel-Päckchen, umgeben von kleinen, schwarzen Kötteln. Mein erster Gedanke? Sofort den örtlichen Schädlingsbekämpfer anrufen.
Moment: Wir reden hier von einer Insel mit kaum mehr als 1000 Einwohnern, 24 Dollar Fährfahrt vom Festland entfernt. Hier rufen Sie niemanden an. Sie machen es selbst.

Ich musste mir von einem Nachbarn altmodische Schnappfallen leihen, sie strategisch platzieren und – halt dich fest – die Überreste selbst entsorgen. Das war der Moment, in dem die Romantik schnell verflog. Die Inselidylle sah anders aus, als ich es mir vorgestellt hatte.
Die Stadtmensch-Falle: Warum Planung hier überlebenswichtig ist
In Seattle kaufte ich Milch, wenn mir die Milch ausging. Maximal zehn Minuten Fahrt. Auf der Insel ist das eine logistische Meisterleistung. Wenn Sie hier etwas vergessen, ist es weg. Oder Sie warten auf die nächste Fähre.
Diese drei Dinge ändern sich radikal, wenn Sie auf eine abgelegene Insel ziehen:
- Der Supermarkt: Es gibt ihn, aber er ist ein Luxusladen mit Wucherpreisen für Grundnahrungsmittel. Milch, Kaffee, das Nötigste.
- Die Autonomie: Sie sind für alles selbst verantwortlich. Von der Reparatur bis zur Notfallversorgung.
- Die Definition von Pünktlichkeit: Fährzeiten sind Vorschläge, und Stürme können Sie für Tage isolieren.
Der Lerneffekt: Warum die Einsamkeit mich besser machte
Trotz der Mäuse und der logistischen Kopfschmerzen passiert hier etwas Faszinierendes. Der permanente Druck, „erreichbar“ zu sein, die ständige Geräuschkulisse der Stadt – das fällt weg. Und siehe da: Meine Konzentration kommt zurück.
Ich bemerkte, dass ich **stundenlang schreiben** konnte, ohne dass mein Gehirn nach Ablenkung schrie. Dinge, die in der Stadt nur Theorie waren (lange Strandspaziergänge, ausprobieren neuer Rezepte), sind hier Alltag.

Die erzwungene Langsamkeit zwingt Sie, Entscheidungen zu überdenken. Brauche ich das wirklich? Kann ich es ersetzen? Das ist ein Luxus, den wir Stadtbewohner komplett verlernt haben. Wir sind gewohnt, dass alles sofort verfügbar ist.
Der Testlauf: Sind 90 Tage genug?
Ich stehe noch am Anfang meines 90-Tage-Experiments. Die Winterstürme weichen langsam dem frühen Frühling, und die Insel erwacht. Ich will die „Flitterwochenphase“ überwinden und ehrlich prüfen, ob die Nachteile (Stromausfälle, vergessene Schlüssel, kranke Hunde am Weihnachtsabend, die zur Notaufnahme müssen) erträglich sind.
Ich genieße diesen Zustand des Beobachtens und des intensiven Arbeitens. Ich habe Adler beim Nisten gesehen und in einer einzigen Woche mehr geschrieben als sonst in vier Wochen Stadtleben. Ob ich bleibe? Das weiß ich erst, wenn die letzten Kisten ausgepackt sind – geistig wie physisch.
Was denken Sie: Würden Sie für ein stabileres Innenleben die Stadt-Annehmlichkeiten (Shopping, Kultur, schnelle Hilfe) aufgeben? Erzählen Sie mir Ihre Meinung in den Kommentaren!